Datenschutz und Schweigepflicht in der Sozialen Arbeit

Fakt ist: In der Sozialen Arbeit sind Datenschutz und Schweigepflicht entscheidende Bedingungen für die Begründung und Aufrechterhaltung des Vertrauensverhältnisses zwischen Sozialarbeiter und Klient. Das heißt aber nicht, dass damit automatisch das Einverständnis des Klienten zur Weitergabe anvertrauter Daten gegeben ist, auch nicht, um Verfahrensabläufe zu erleichtern.
Darüber hinaus treffen in der Sozialarbeit komplexe Rahmenbedingungen und Interessenlagen aufeinander. So sind etwa Einrichtungen der Jugendhilfe nicht nur Kindern und Jugendlichen verpflichtet, sondern auch Jugendämtern und Eltern. Zudem bestehen meist weitere Rechtsbeziehungen zu Behörden, Schulen, der Polizei sowie Familien- und Strafgerichten, die ihre eigenen, teils konträren Handlungsaufträge zu erfüllen haben. Innerhalb dieses Spannungsfeldes agiert der Sozialarbeiter, der zwischen den teils nur für seine Ohren bestimmten Informationen und einer ggf. notwendigen Weitergabe abwägen muss.
Sozialarbeiter als Geheimnisträger
Alle Berufsgruppen im Sozialbereich, ehrenamtliche Hilfskräfte eingeschlossen, bewegen sich datenschutzrechtlich auf dünnem Eis. Sie sind anfangs „einer vom Amt“, später Gesprächspartner, dem Lebenslauf, Krankheitsbiografie, Familienprobleme, finanzielle Notlagen, politische Ansichten oder Sexualleben anvertraut werden. Auch strafrechtlich relevante Informationen wie etwa Personen bzw. Orte zur Beschaffung von Drogen, Eingeständnisse von Straftaten oder Verdachte von Kindeswohlgefährdung können darunter sein. Was davon ist nichts für fremde Ohren, wann ist eine Weitergabe angezeigt und wann kann eine Verpflichtung daraus erwachsen?
§ 203 StGB verpflichtet bestimmte Berufsgruppen, u. a. Mitarbeiter von staatlich anerkannten 
Bedeutet?
– „fremde Geheimnisse“: sind nur einem eingeschränkten Personenkreis bekannt.
– „anvertraut“: dem Sozialarbeiter werden Geheimnisse seines Berufs wegen und in der Erwartung anvertraut, dass diese vertraulich behandelt und keinem Dritten übermittelt werden. Dabei ist es unerheblich, ob die Mitteilung mit einer beantragten Hilfeleistung verbunden ist.
– „unbefugt“: es liegt kein Rechtfertigungsgrund vor.
– „offenbaren“: schließt die mündliche Informationsweitergabe an andere Personen, die Zustimmung zur Akteneinsicht oder auch das Herumliegenlassen von Akten ein. Zudem ist es unwesentlich, ob für die anderen Personen auch die Schweigepflicht gilt!
Ein verantwortungsvoller Umgang mit personenbezogenen Daten ist also einerseits Selbstschutz, macht aber andererseits erst vertrauliche und erfolgreiche Hilfeprozesse überhaupt erst möglich.
Aber: Diplomierte Pädagogen und Erzieher unterliegen nicht der Strafdrohung nach § 203 StGB, sind aber nichtsdestotrotz entsprechend Arbeitsvertrag und Zivilrecht zur Verschwiegenheit verpflichtet. Verstöße haben allerdings keine strafrechtlichen, sondern zivil- und berufsrechtliche Konsequenzen.
Verhinderung von Straftaten kommt vor Datenschutz
Das Datenschutzrecht verbietet nicht grundsätzlich die Weitergabe von Daten, insbesondere dann, wenn damit Straftaten verfolgt werden können. Jeder hat eine Anzeigepflicht, wenn mit bekannt gewordenen Informationen eine schwere Straftat (z. B. Mord, Menschenhandel) verhindert werden kann.
Aber: Sofern etwa Sozialarbeitern Straftaten aus der Vergangenheit anvertraut werden, besteht diese Anzeigepflicht nicht!
Vom Grundsatz her muss auch niemand bei der Polizei Angaben zur Person machen, denn die Aussagepflicht gilt nur gegenüber der Staatsanwaltschaft und dem Strafgericht. Dies gilt explizit für Sozialpädagogen und ihre „beruflichen Gehilfen“ wie Erzieher, Jugendpfleger oder Heilpädagogen.
Geschützter Umgang mit persönlichen Daten
Die Schweigepflicht gilt für jeden selbst, nicht für die Institution oder Behörde. Damit kann der Chef kraft seines Amtes die Weitergabe von Daten und Geheimnissen nicht anordnen! Aber: Werden z. B. bei Dienstberatungen Daten zu Klienten an das Team weitergegeben, muss der Klient darüber informiert sein und ausdrücklich eingewilligt haben, anderenfalls ist eine kollegiale Fallbesprechung nur anonymisiert möglich. Auch Aktenvermerke über persönliche Gespräche sind geschützt, so lange niemand zur Akteneinsicht ausdrücklich befugt ist (Einwilligungspflicht!).
Besonders bei Hilfeplanungen ist es notwendig, vor Beginn mit dem Klienten das Verfahren genau zu besprechen, so dass Klarheit besteht, welche Informationen bzw. Aufgaben dokumentiert und was davon ggf. an andere Einrichtungen und Sozialleistungsträger weitergegeben werden soll. Der Datenverwendung und die Weitergabe an Dritte ist schriftlich zu vereinbaren.
In der Praxis? Liegt oft für die Weitergabe von Klientendaten im Kollegenkreis keine Einverständnis der Betroffenen vor. Auch E-Mails werden nicht verschlüsselt an das Team gesendet, zudem Daten per SMS, WhatsApp oder Messenger ausgetauscht. Im Gegenzug schicken auch Klienten ihre Daten über soziale Medien oder Chats an Sozialarbeiter, obwohl Informationen aus unsicheren Kommunikationskanälen nicht angenommen werden dürften, selbst wenn die Übermittlung durch den Klienten selbst erfolgt. Der saubere (aber aufwändigere) Weg wäre die Löschung der Nachricht mit dem Hinweis an den Klienten, über ein anderes Medium zu kommunizieren, zumal Klientendaten überhaupt nicht in soziale Netzwerke gelangen sollten.
WhatsApp & Co in sozialen Unternehmen
Sozialarbeiter kommunizieren mit Klienten zur Terminvereinbarung, Datenübermittlung oder aus Kostengründen per WhatsApp. Dennoch macht die Technik heute nicht nur die Übertragung der Telefonnummer, sondern auch der IP-Adresse und weiterer personenbezogener Daten sowie das Auslesen des Telefonbuchs möglich. Daher ist vom dienstlichen Einsatz von WhatsApp abzuraten, es sei denn, der Sozialarbeiter stimmt dem zu und hat vor Nutzungsbeginn von all seinen gespeicherten Kontakten eine Einverständniserklärung für die Datenweitergabe eingeholt sowie mit dem Anbieter einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG geschlossen. Beides ist eher unwahrscheinlich.
Nutzung von mobilen Geräten und Clouds
Auch wenn es bequem ist: Smartphones, Tablets und Laptops sollten nicht gleichzeitig beruflich und privat genutzt werden. Wenn eine Trennung nicht praktikabel ist, dann sind WhatsApp, Messenger oder andere Online-Dienste tabu. Dringt der Arbeitgeber auf eine telefonische Erreichbarkeit – bei Sozialarbeitern durchaus gängig – dann muss ein Diensthandy her, weil die Nutzung eines Telefons mit zwei SIM-Karten viel zu umständlich wäre.
Die Speicherung von Klientendaten erfordert sichere Dienste, so dass etwa Cloud-Anbieter mit Datenauslagerungen oder Servern in den USA dafür ungeeignet sind. Ob jedoch europäische Cloud-Dienste ausreichend Sicherheit bieten, muss im Einzelfall geklärt werden.
FAZIT:
Die Einhaltung von Datenschutz und Schweigepflicht in der täglichen sozialen Arbeit ist anstrengend und 
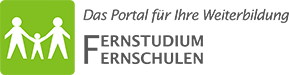

 Mit Mediation konnten wir bis vor einigen Jahren noch nicht viel anfangen, denn wir haben „Kraft unserer Wassersuppe“ ein eigenes
Mit Mediation konnten wir bis vor einigen Jahren noch nicht viel anfangen, denn wir haben „Kraft unserer Wassersuppe“ ein eigenes  Wenn Besucher, Eltern, Neugierige oder stille Beobachter über das Angebot, die Einrichtung oder die tätigen
Wenn Besucher, Eltern, Neugierige oder stille Beobachter über das Angebot, die Einrichtung oder die tätigen 